Seit über fünf Jahren begleite ich die öffentliche Debatte um meine Person – zunächst als Initiator der ersten Grundrechtsdemonstrationen im Jahr 2020, später als Angeklagter in einem Verfahren, das inzwischen mehr als 40 Verhandlungstage umfasst. In dieser Zeit habe ich viel über die Macht der Sprache gelernt – und über das Framing in der Berichterstattung.
Der aktuelle Artikel von Eberhard Wein in der Stuttgarter Zeitung ist ein gutes Beispiel dafür. Er erscheint auf den ersten Blick sachlich – nutzt aber eine Sprache, die subtile Wertungen transportiert.
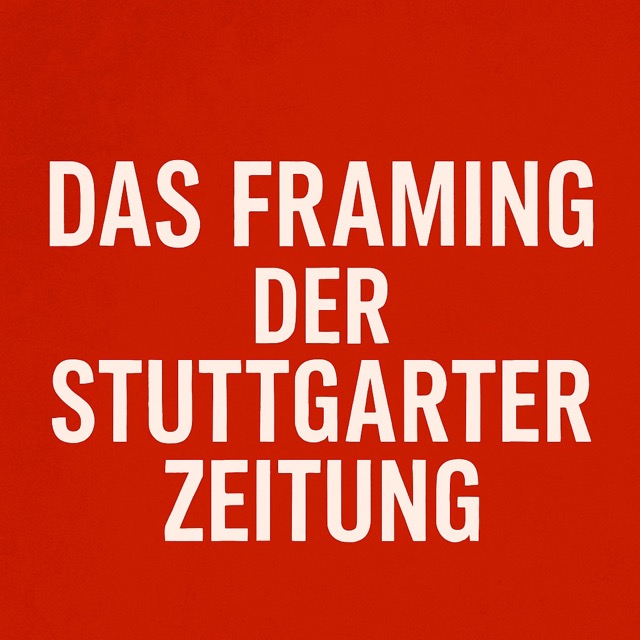
Einordnung und Bewertung des Artikels
Der Artikel thematisiert mein Kryptovermögen im Kontext des laufenden Strafverfahrens. Die Darstellung wirkt in weiten Teilen zurückhaltend, enthält aber Formulierungen und Fragestellungen, die aus PR-Sicht problematisch sind:
- Framing durch Fragestellung
Bereits die Überschrift „Warum hat Michael Ballweg Querdenken-Geld in Bitcoins angelegt?“ ist suggestiv. Sie unterstellt einen problematischen Zusammenhang – obwohl das Gericht mehrfach betont hat, dass die Verwendung von Kryptowährungen nicht unzulässig ist. - Widersprüchliche Darstellung der Mittelverwendung
Obwohl im Artikel selbst zitiert wird, dass das Gericht keine Hinweise auf Geldwäsche oder private Bereicherung sieht, wird gleichzeitig die Anlage in Kryptowährungen als „hochspekulativ“ problematisiert. Damit wird eine Risikodiskussion eröffnet, die mit der juristischen Bewertung nichts zu tun hat. - Unklare Begriffe
Der Begriff Spenden wird durchgängig verwendet – obwohl es sich rechtlich um Schenkungen handelt. Die steuerliche Bewertung von Schenkungen ist deutlich differenzierter als bei Spenden. Diese Unterscheidung bleibt im Artikel unerwähnt. - Implizite Vorverurteilung
Die Aussage „Ballweg lehnt Geldauflage ab – Forderung nach Freispruch“ wird zwar korrekt wiedergegeben, aber in einem Kontext dargestellt, der meine Haltung irrational erscheinen lässt. Tatsächlich setzt eine Einstellung nach § 153a StPO ein Schuldeingeständnis voraus – das ich ausdrücklich ablehne.
Die Frage lenkt – nicht die Antwort
Die Überschrift des Artikels suggeriert einen Zusammenhang zwischen QUERDENKEN-Geldern und Bitcoin-Investitionen, den das Gericht in keiner Weise bestätigt hat. Die wiederholte Feststellung: Es gibt keinen Beweis für Betrug oder Zweckentfremdung. Die Verwendung von Kryptowährungen ist rechtlich zulässig – das wurde vom Gericht mehrfach klargestellt. Dennoch wird eine Frage gestellt, die ein Problem behauptet, das juristisch gar nicht existiert.
Framing durch Sprache – und durch das, was fehlt
Während der Artikel korrekt zitiert, dass das Gericht keine Anhaltspunkte für eine private Bereicherung sieht, wird gleichzeitig die Investition in Bitcoin als „hochspekulativ“ bezeichnet – ein Begriff aus dem Finanzjournalismus, nicht aus einem Gerichtsbericht. Damit wird ein Bild erzeugt, das nicht zu den tatsächlichen Inhalten des Verfahrens passt.
Hinzu kommt die irreführende Wortwahl bei der Mittelherkunft. Es handelt sich nachweislich um Schenkungen – und nicht um Spenden. Schenkungen sind nicht automatisch zweckgebunden – außer, der Schenker hat dies ausdrücklich erklärt. Diese Differenzierung wäre wichtig gewesen – wird im Artikel aber ausgeklammert.
Wie ich mit der Berichterstattung umgehe
- Souveräne Gelassenheit
Der Artikel enthält typische Zuspitzungen, wie sie im Journalismus häufig vorkommen. Die sachliche und transparente Reaktion des Presseteams war daher der richtige Weg. - Kernbotschaften wiederholen
- Es gibt keinen Nachweis für zweckwidrige Verwendungen.
- Die rechtliche Bewertung der Kryptowährungen ist neutral – es liegt keine Illegalität vor.
- Ich bestehe auf vollständiger Aufklärung oder Freispruch – keine Deals ohne Rehabilitierung.
- Die Staatsanwaltschaft hat bereits eine Einstellung geprüft, diese jedoch aus formalen Gründen nicht weiterverfolgt.
- Vorausschauende Kommunikation
Der mögliche Anstieg des Bitcoin-Werts sollte nicht als „Gewinn“ interpretiert werden – Bitcoin ist volatil. - Klare Sprache statt Spekulation
Begriffe wie „hochspekulativ“, „Blase“ oder „vermeintlich“ sollten in offiziellen Reaktionen vermieden werden. Stattdessen gilt es, auf Dokumentation, Transparenz und die rechtliche Bewertung durch das Gericht zu setzen.
Die Geschichte wiederholt sich
Diese Form der Berichterstattung ist kein Einzelfall – sie folgt einem Muster, das seit 2020 immer wieder zu beobachten ist. Wer Kritik an Maßnahmen geäußert hat, wurde öffentlich diffamiert. Nicht nur ich, sondern auch hunderttausende friedliche Teilnehmer an Demonstrationen wurden pauschal ausgegrenzt, ohne dass man sich ernsthaft mit ihren Anliegen auseinandergesetzt hätte.
Statt sachlicher Analyse dominierten mediale Etikettierungen – in offenem Widerspruch zum Pressekodex. Journalistische Mindeststandards wie Quellenprüfung, Trennung von Meinung und Bericht oder die Pflicht zur Sorgfalt wurden systematisch verletzt. Beschwerden beim Presserat verpufften, viele Redaktionen gaben sich selbst Rückendeckung. Die mediale Selbstkontrolle hat vollständig versagt.
Und wer das für eine einseitige Kritik hält, dem sei ein Satz von Alena Buyx in Erinnerung gerufen – der damaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, der selbst tief in das Pandemiemanagement eingebunden war. In einer Podiumsdiskussion 2024 sagte sie:
„Und im Übrigen, Sie wären da ja nicht außen vor. Das wissen Sie ganz genau. Also das würde die Medienschaffenden ganz genauso betreffen.“ – Alena Buyx
Dieser Satz war nicht als Entschuldigung gemeint – sondern als unfreiwillige Bestätigung: Auch der Ethikrat und große Teile der Medien waren Teil des Problems. Und sie wissen es.
Bereits 2020 wurden unsere Versammlungen auf dem Cannstatter Wasen als Gefahr dargestellt – obwohl sie friedlich, dezentral organisiert und durch das Grundgesetz gedeckt waren. 2022 folgte die mediale Begleitung meiner Untersuchungshaft, bei der nicht Fakten, sondern Narrative dominierten. Und auch heute – fünf Jahre später – wird mein Recht auf Verteidigung gegen unbegründete Vorwürfe in einen Kontext gerückt, der Misstrauen schürt statt Aufklärung zu ermöglichen.
Die Mechanismen sind gleich geblieben. Nur der Vorwurf hat sich verändert.
Die ganze Analyse lesen
Das Anwaltsteam hat die Fragen der Stuttgarter Zeitung vollständig dokumentiert und sachlich beantwortet. Die Medienkritik mit sämtlichen Details ist als Blog-Beitrag auf querdenken-711.de veröffentlicht:
Bitcoin, Ballweg und die Wahrheit – Was wirklich hinter dem Artikel der Stuttgarter Zeitung steckt